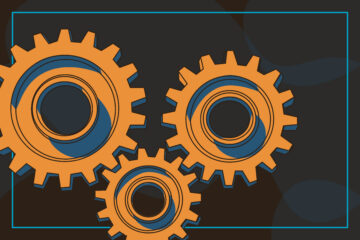Blamage vor Gericht: Wenn die KI „halluziniert“ – und der Anwalt den Schriftsatz nicht prüft
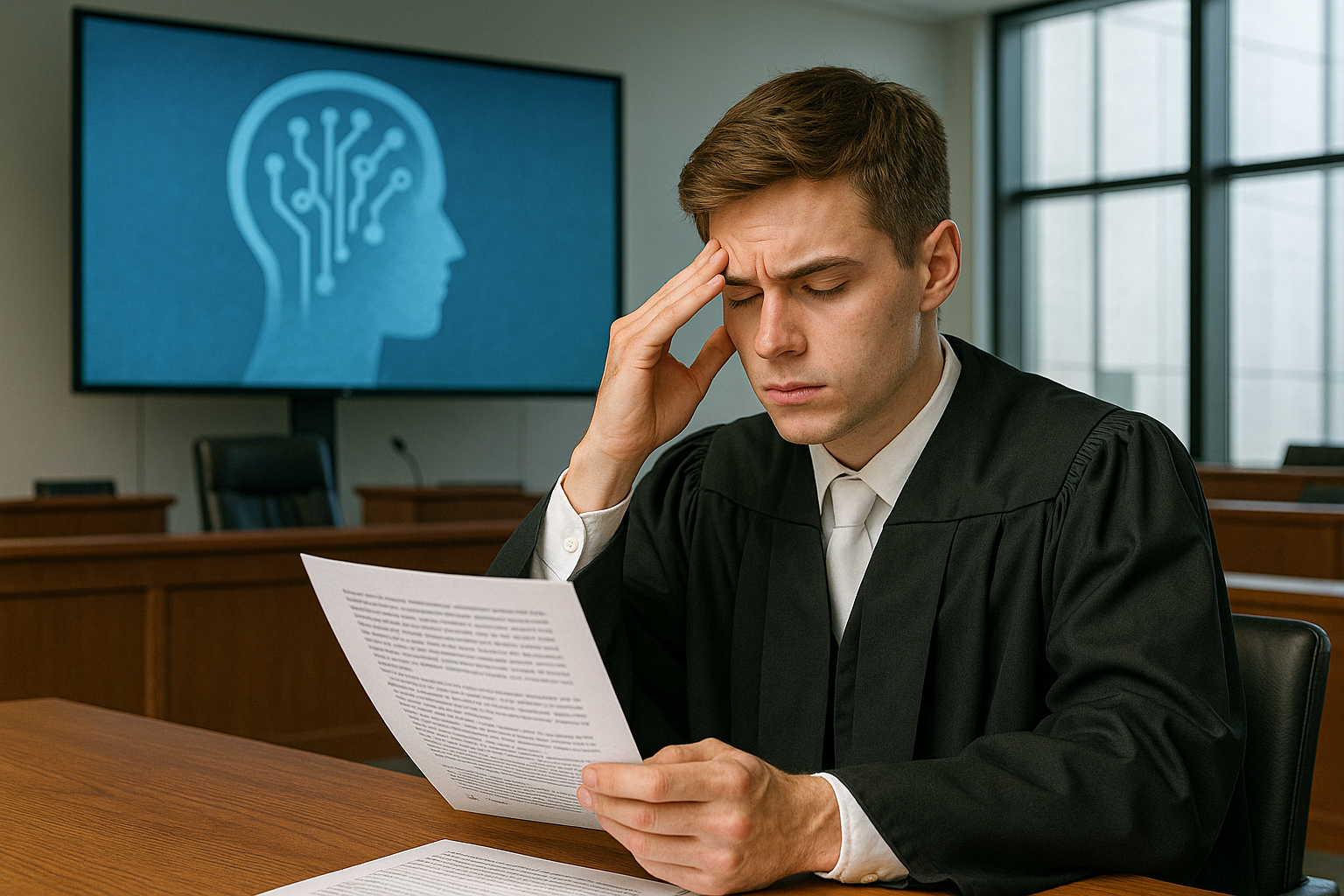
Ein Schriftsatz mit erfundenen Zitaten und fehlgeleiteten Quellen – was in einer Familiensache vor dem Amtsgericht (AG) Köln geschah, hat unter Juristen für Aufsehen gesorgt. Das Gericht sprach von einem Berufsrechtsverstoß und übte ungewöhnlich scharfe Kritik an einem Fachanwalt für Familienrecht. Kern des Problems: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, ohne die generierten Inhalte kritisch zu überprüfen (AG Köln, Beschluss vom 02.07.2025 – 312 F 130/25).
Inhalt
Der Fall: KI „halluziniert“ – und der Anwalt reicht’s ein
In einem Verfahren zum Sorgerecht reichte der Anwalt einen Schriftsatz ein, der nach Einschätzung des Gerichts „offenbar mittels künstlicher Intelligenz generiert“ worden war. Die zitierte Literatur und die genannten Gerichtsentscheidungen waren frei erfunden, existierten nicht oder betrafen ganz andere Sachverhalte. Das Gericht fand für viele angeführte Quellen keinen realen Anhaltspunkt. Ein Kollege des gegnerischen Anwalts hatte auf LinkedIn einen Post über den Fall veröffentlicht und löste kontroverse Diskussionen aus.
Die gerichtliche Entscheidung im Detail
Das AG Köln nahm in seinem Beschluss kein Blatt vor den Mund: Der Schriftsatz sei unbrauchbar und irreführend gewesen. Erschwerend komme hinzu, dass er „dem Ansehen des Rechtsstaats und der Anwaltschaft empfindlich“ schade. Der Anwalt sei künftig verpflichtet, derartige Ausführungen zu unterlassen. Insbesondere als Fachanwalt für Familienrecht sollte der betroffene Anwalt die rechtlichen Gegebenheiten kennen.
Darüber hinaus wies das Gericht auf § 43a Abs. 3 BRAO hin: Das bewusste Verbreiten von Unwahrheiten stelle einen Berufsrechtsverstoß dar. Insbesondere dann, wenn über Inhalte von Gesetzen oder Entscheidungen wissentlich falsche Angaben gemacht würden.
KI-generierter Schriftsatz: Berufsrechtsverstoß oder Schlamperei?
Der Kern der juristischen Debatte liegt in der Frage, ob ein solcher Schriftsatz tatsächlich gegen berufsrechtliche Pflichten verstößt – und falls ja, ob dies bewusst geschah. Denn: Die Vorschrift des § 43a Abs. 3 BRAO setzt ein „unsachliches Verhalten“ voraus, das vorsätzlich erfolgt.
Rechtlich unklar ist bislang, wie mit offensichtlich falschen Quellenangaben umzugehen ist, wenn sie durch eine KI generiert wurden. Kritisch wird es dann, wenn Anwält:innen die Angaben ungeprüft übernehmen. Der Grat zwischen Fahrlässigkeit und bedingtem Vorsatz ist hier schmal – aber entscheidend für die berufsrechtliche Bewertung.
Passend dazu: Generative KI im Anwaltsberuf: Ein Blick auf die neuen ethischen Richtlinien der American Bar Association (ABA)
Könnte ein ungeprüfter KI-Schriftsatz sogar strafbar sein?
Einige Stimmen in der juristischen Diskussion gehen noch weiter und warfen die Frage auf, ob ein solcher Schriftsatz den Tatbestand des (versuchten) Prozessbetrugs erfüllt. Grundsätzlich ist eine bewusste Täuschung über Tatsachen erforderlich. Der Vorsatz könnte dabei schon dann angenommen werden, wenn der Anwalt Fundstellen übernimmt, ohne sie zu prüfen – also eine mögliche Unwahrheit billigend in Kauf nimmt.
Wenn man eine Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz betrachtet, könnte man zu einem anderen Ergebnis kommen. Das OLG hatte sich bereits 2001 mit einer ähnlichen Konstellation befasst – damals ohne KI. In dem Fall ging es um einen Anwalt, der dem Gericht fälschlich sagte, dass seine Meinung auch von vielen Gerichten geteilt werde. Trotzdem sah das Gericht darin keinen strafbaren Prozessbetrug. Der Grund: Gerichte müssen rechtliche Aussagen ohnehin selbst überprüfen und dürfen sich nicht einfach auf Behauptungen verlassen.
Rechtliche und praktische Folgen für die Anwaltschaft
Unabhängig von der straf- oder berufsrechtlichen Bewertung steht fest: Wer KI-generierte Inhalte in Schriftsätze einbaut, muss deren Richtigkeit prüfen. Andernfalls drohen nicht nur formelle Konsequenzen, sondern auch ein Reputationsverlust. Zudem kann der eigene Fall vor Gericht durch unbrauchbare Schriftsätze erheblich geschwächt werden.
Das AG Köln hat mit seinem Beschluss ein klares Signal gesendet: Die Anwaltschaft bleibt auch im KI-Zeitalter in der Pflicht, sorgfältig und verantwortungsbewusst zu arbeiten.
Checkliste: KI in der anwaltlichen Praxis – Was ist zu beachten?
- Fundstellen immer gegenprüfen – Auch wenn der Text plausibel klingt, muss jede Quelle nachrecherchiert werden.
- Verantwortung bleibt beim Anwalt oder der Anwältin – Die Nutzung von KI entbindet nicht von der Sorgfaltspflicht.
- Fachliche Datenbanken nutzen – KI ohne juristische Fachbasis ist für Schriftsätze ungeeignet.
- Dokumentation der KI-Nutzung – Im Zweifelsfall kann eine interne Dokumentation helfen, Sorgfalt nachzuweisen.
- Auf Struktur und Stil achten – KI-Texte mit Spiegelstrichen oder generischem Aufbau sollten überarbeitet werden.
- Berufsrechtliche Grenzen kennen – § 43a BRAO und § 138 ZPO geben Maßstäbe für die anwaltliche Praxis.
Sie wollen als Telefonanwalt/Telefonanwältin nebenbei Geld verdienen? Kooperieren Sie mit uns!