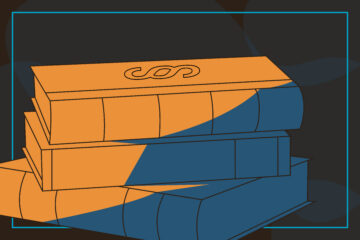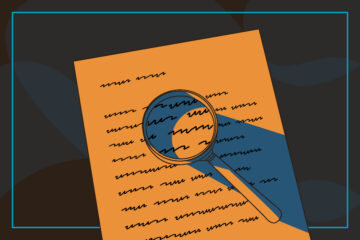Berufungsfrist beginnt mit eEB, nicht ab Mandantenkenntnis

In einem Streit unter Brüdern nach dem Tod ihres Vaters stand nicht nur ein Grundstück, sondern auch die Berufungsfrist im Zentrum des Verfahrens. Ausschlaggebend war die Frage, wann der Anwalt das Urteil tatsächlich entgegengenommen und Kenntnis erlangt hatte – nachdem der Mandant seinerseits vorher bereits den Inhalt zitiert hatte. Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg bezieht in seinem Urteil vom 12.09.2025 (Az. 1 U 2003/24) klar Stellung: Maßgeblich bleibt das elektronische Empfangsbekenntnis.
Inhalt
Streitpunkt: Fristversäumnis trotz früher Zitatkenntnis?
Im Zentrum des Falls stand ein typisches Problem aus der anwaltlichen Praxis: Die Gegenseite bestritt die Fristwahrung der Berufung. Der Kläger hatte in einem Schreiben vom 10.09.2024 bereits das Urteil vom 04.09.2024 zitiert. Da die Berufung aber erst am 15.10.2024 eingelegt wurde, sah man die Monatsfrist nach § 517 Zivilprozessordnung (ZPO) als abgelaufen an.
Der Klägeranwalt verwies auf das über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) abgegebene elektronische Empfangsbekenntnis (eEB), welches eine Kenntnisnahme am 16.09.2024 dokumentierte. Somit wäre die Berufung fristgerecht.
Gerichtliche Bewertung: Beweiskraft des eEB überwiegt
Das OLG Nürnberg bestätigte die Wirksamkeit des eEB: Es erbringe – ebenso wie das klassische Empfangsbekenntnis – den vollen Beweis der Zustellung. Auch wenn das Urteil bereits früher zitiert wurde, sei dies kein ausreichender Gegenbeweis für einen tatsächlich früheren Zugang beim Anwalt.
Zwar könne ein Gegenbeweis grundsätzlich geführt werden. Dieser müsse aber so überzeugend sein, dass die Richtigkeit des eEB „in jeder Hinsicht ausgeschlossen“ werde. Weder die frühere inhaltliche Kenntnis des Mandanten noch die 12 Tage zwischen Versand und Empfang belegten dies, zumal der Anwalt sich im Urlaub befand.
Dass der Kläger das Urteil schon zitierte, erklärte sich dadurch, dass er selbst bei der Verkündung anwesend war – die förmliche Zustellung sei aber weiterhin an den Rechtsanwalt gebunden.
Digitale Zustellung bleibt formal gebunden
Entscheidend für die Zustellung bleiben die Kenntniserlangung und empfangsbereite Entgegennahme durch den Anwalt, nicht eine informelle Kenntnisnahme durch die Partei. Damit stärkt das OLG die Verlässlichkeit des elektronischen Empfangsbekenntnisses – trotz praktischer Herausforderungen wie Urlaubszeiten oder interner Arbeitsabläufe in Kanzleien.
Auch inhaltlich bringt Berufung Teilerfolg
In der Hauptsache ging es um die Herausgabe eines Grundstücks, das der eine Bruder vom Vater übertragen bekommen hatte – im Gegenzug für Pflegeleistungen, eine Leibrente sowie die Einräumung eines Nießbrauchs. Der andere Bruder hielt dies für eine gemischte Schenkung und verlangte die Herausgabe des Grundstücks nach § 2287 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Das OLG bestätigte im Wesentlichen die Bewertung des Regensburger Landgerichts (LG): Bei der Rückforderung des Grundstücks sind alle vereinbarten Gegenleistungen (Nießbrauch, Wartung/Pflege, Leibrente) voll mit ihrem wirtschaftlichen Wert anzusetzen, der hier ungefähr 65.000 Euro entspricht. Diese werden mit einer Schenkung von 55.000 Euro verrechnet. Es verbleibt nur knapp unter 10.000 Euro, die Zug-um-Zug für die Übereignung des Grundstücks zu zahlen sind.
Urteilszusammenfassung für die anwaltliche Praxis:
- eEB hat Beweiskraft: Ein elektronisches Empfangsbekenntnis gilt als vollwertiger Nachweis der Zustellung.
- Kenntnis der Partei genügt nicht: Informelle Vorabinformationen oder Mitteilungen der Partei ersetzen keine Zustellung an den Anwalt.
- Zustellung ≠ Versand: Entscheidend ist die Kenntnisnahme durch den Rechtsanwalt – nicht der Versandzeitpunkt.
- Urlaub schützt nicht automatisch: Zwar wurde der Urlaub in dem Fall berücksichtigt, aber eine klare Vertretungsregelung bleibt angeraten.
- Wertausgleich bei gemischter Schenkung: Bei Rückforderung von Vermögensübertragungen nach § 2287 BGB sind alle erbrachten Gegenleistungen sorgfältig zu beziffern.